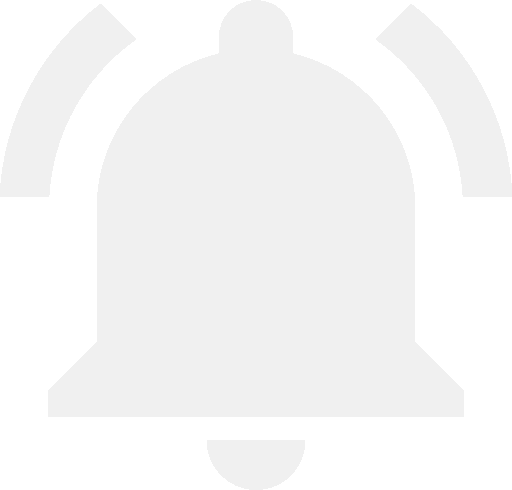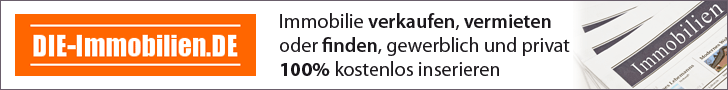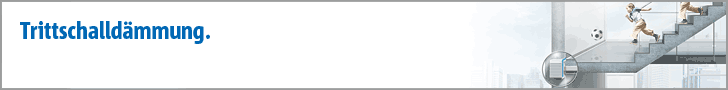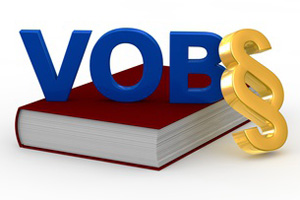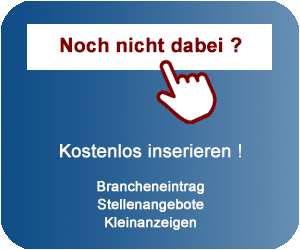11 spektakuläre Holzhochhäuser


Holz ist eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit. Und wie wir heute wissen, ist die CO2-Bilanz von Holzbauten im Vergleich zu Beton ist unschlagbar gut. Jetzt, da Klimaschutz immer dringlicher wird, erlebt der Hausbau mit Holz eine Renaissance. Neuerdings auch in Form von Holzhochhäusern in den Städten. Innovative baustatische und konstruktive Erkenntnisse lassen solche Woodscraper längst über 100 Meter anwachsen. Wir stellen 11 spektakuläre Holzwohntürme aus aller Welt vor, geplante und bereits gebaute.
In Deutschland gelten Bauten ab 22 Meter schon als Hochhaus. In Österreich sind es 35 Meter. Das schienen Grenzen, die man dem Baustoff Holz nicht zutraute. Statische Bedenken und Sorge wegen Brandgefahr dominierten. Da die konventionelle Bauwirtschaft laut Angaben des World Green Building Council für fast 40 Prozent der weltweit energiebedingten CO?-Emissionen verantwortlich ist, hat man nochmal neu nachgedacht.
„Holzhochhäuser werden mittlerweile weltweit gebaut. Die Idee, Holz neben Beton und Stahl als tragenden Baustoff im Geschosswohnungsbau einzusetzen, findet international Resonanz“, schreibt das Portal holzbauwelt.de und begründet das, „dank neuester Holz-Technologien mit den Holzwerkstoffen Brettschichtholz, Cross Laminated Timber (CLT) / Brettsperrholz ist es möglich, geschossweise über die Hochhausgrenze von 22 Metern zu kommen.“
In unseren Beispielen unten sind sogar Höhen bis 350 Meter angepeilt, wenn auch noch nicht gebaut.
Auch Brandschutztests sprechen für Holz. Denn brandschutztechnisch hält ein massiver Holzbalken oder ein Brettschichtverbundstoff sowie Leimbinder-Holz mit adäquaten Durchmesser einem Brand ebenso Stand, wie vergleichbare Stahlbetongewerke.
Zum Thema Klimaschutz kann der Holzbau ganze Seiten mit positiven Erkenntnissen füllen. An dieser Stelle sparen wir uns weitere Erläuterungen, Informationen dazu stehen jeweils bei den unten erwähnten Projekten dabei.
1. River Beech Tower Chicago/USA 280 m
Als sich die Architekten bei Perkins & Will mit Forschern der Universität Cambridge und Ingenieuren bei Thornton Tomasetti zusammenschlossen, ging es um die völlige Neuentwicklung eines rund 280 Meter hohen Wohnturms aus Massivholz. Der modulare River Beech Tower-Entwurf ist mit seinen 80 Geschossen ein Wolkenkratzer, der seine enorme Höhe ganz ohne Stahl und Beton erreichen soll. Rund 300 Wohnappartments soll der Turm beherbergen.
Die Planer nennen ihren neuen Denkansatz eine „Revolution im nachhaltigen Wolkenkratzer-Design“. Es geht um nichts weniger als die bisherigen statischen Limits, die dem Baumaterial Holz nachgesagt werden, aufzuheben. Während andere versuchen würden, Betonkonstruktionen in Holz umzusetzen, hätten sie bei ihren Überlegungen bei Null begonnen. Als Ausgangsparameter dienten
lediglich die derzeit am Markt befindlichen Holzprodukte Brettsperrholz (CLT) und Brettschichtholz (engl. Glulam). Während sich das kreuzverleimte Sperrholz gut für tragtende Wand- und Deckenplatten eignet, liegen die Vorteile bei Brettschichtholz im Einsatz bei tragende Balken und Stäben.
Daraus entwickelten Sie eine Gebäudehülle in Form einer hochsteifen Gitterstruktur.
Ein Tragwerksystem mit sich überkreuzenden Trägern, ein sogenanntes Diagrid, das modular mit Brettschichtholz aufgebaut ist. Diese netzartige Struktur ist doppelt vorhanden, außen und innen. Durch die kraftschlüssige Verbindung beider Strukturen erfolge eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Holzelemente, erläutern die Planer. In einem interview erklärte Andrew Tsay Jacobs, Leiter des Building Technology Labs von Perkins + Will: „Mit Holz lassen sich problemlos 80 Stockwerke bauen. Die Hürden liegen nicht so sehr auf der technischen, als auf der Seite der Bauverordnungen.“
Die CO2-Einsparung von solchen Holzhochhäusern wäre gegenüber konventionellem Stahlbetonbau enorm. Perkins Will betonen: „Der Massivholzbau ist aufgrund der Verwendung erneuerbarer Materialien und der modularen Fertigung, bei der nur sehr wenig Abfall und Kohlendioxidemissionen entstehen, äußerst nachhaltig.“ Ob und wann das Projekt realisiert wird, ist derzeit noch unklar.
2. Roots Hamburg/D 65 m
Hamburger Architekten von Störmer, Murphy and Partners. Fotograf Daniel Sumesgutner .
„ein 19-stöckiges Holzbauhochhaus. Insgesamt werden hier 181 Wohnungen realisiert sowie Ausstellungsräume und die Verwaltung der Deutschen Wildtier Stiftung.
Mit dem Projekt „Roots“ der Hamburger Architekten von Störmer, Murphy and Partners entstand in der Elbbrückenquartier der Hamburger HafenCity ein 18-stöckiges Holzbauhochhaus mit fünfeckigem Grundriss . Mit seinen 65 Metern ist es das höchste Holz(hybrid)hochaus Deutschlands. Diesen Titel trug bisher das „Carl“ in Pforzheim (45 Meter). Insgesamt wurden hier 181 Wohnungen realisiert - davon 128 Eigentumswohnungen und 53 öffentlich geförderte - sowie Ausstellungsräume und die Verwaltung der Deutschen Wildtierstiftung. Auch Gastronomie gibt es.
Alle Obergeschosse sind mit Massivholzdecken und -innenwänden errichtet, nur Unter- und Erdgeschoss sowie die Erschließungskerne (wie Aufzüge) des Hybridbaus wurden als Stahlbetonkonstruktion geplant.
Der Holzbau für Turm, Querbau und Riegelgebäude von Roots wurde in nur 16 Monaten fertig montiert. Gefertigt wurden die Holzmodule von den Ingenieurholzbau-Spezialisten Rubner aus Augsburg. Andreas Fischer, Geschäftsführer von Rubner erläuterte nicht ohne Stolz in einem Interview: „Dabei war der Vorfertigungsgrad und die werksseitige Ausführung der
Holzrahmenbau-Außenwände maximal komplex. So wurden die bis zu 14 Meter langen, 3,2 Meter hohen und zum Teil über 6 Tonnen schweren Elemente nicht nur als lineare, sondern bereits als räumliche Module vorgefertigt. Die hier in nur 16 Monaten in der Holzbaumontage realisierte Tragwerksstruktur, für die die lastabtragenden Stützen der 16 Holzgeschoße bereits im Werk in die Wandelemente integriert wurden, machen das Roots zu einem Best-Practice-Beispiel, an dem sich mittlerweile ähnlich gelagerte Holzbauprojekte orientieren.“
Diese Bauweise trägt nicht nur zur Reduktion des CO?-Fußabdrucks bei, sondern begrenzt auch Lärmemissionen bei der Umsetzung und lässt ein gesundes Raumklima entstehen.
Zum Schutz vor Witterung, Lärm und Bränden bekam das Roots eine gläserne Fassade. So lassen sich die Balkone wetterunabhängig nutzen. Am Wasser kann es in der Höhe auch mal windig werden.
Laut den Architekten, spart das Roots gegenüber einem Bau mit herkömmlichen Materialien 26.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. 4657 Kubikmeter Holz wurden verbaut.
3. Timber Marina Tower Wien/A, 113 m
Nach sechsjähriger Planungs- und Genehmigungsphase kam der Wiener Gemeinderatsbeschluss Anfang 2025 zustande: Der Timber Marina Tower wird mit einer Höhe von 113 Meter gebaut. Er soll in Holzhybrid-Bauweise errichtet werden und wäre nach Fertigtellung eines der höchsten Holzhochhäuser, zumindest in Europa. Projektentwickler UBM – Spezialist für große Holzbau-Projekte, spricht gar vom höchsten Holzhochaus der Welt. Diese Einschätzung dürfte jedoch von aktuellen Bauereignissen überholt werden.
Standort des marina Timber Tower ist die Wiener Waterfront im 2. Bezirk, ein urbanes Entwicklungsgebiet am rechten Donauufer, direkt gelegen an der U2-Station Donaumarina. Dort residiert bereits ein Hochhaus-Kollege in unmittelbarer Nachbarschaft - der Marina Tower, quasi ein Namensvetter. Der wurde aber in konventioneller Stahl-Beton-Bauweise errichtet. Fertiggestellt wurde dieser 144 Meter hohe Wohnturm 2022. Er umfasst über 500 Wohnungen auf 41 Stockwerken. Ein imposantes Bauwerk mit markanter Fassade. Demgegenüber wird der Timber Marina Tower keine Wohnungen bieten, sondern eine Mischnutzung aus Büros, Seminarräumen, Gastronomie und Co-Working Spaces. Der Timber Marina Tower basiert auf dem 2019 in einem internationalen Wettbewerb ausgewählten Siegerprojekt von Dominique Perrault und Hoffmann-Janz. Das adaptierte Siegerprojekt weist 32 Obergeschoße und 4 Tiefgeschoße auf und umfasst insgesamt 44.000 Quadratmeter Geschoßfläche.
Das Gebäude wird der EU-Taxonomie und den ESG-Richtlinien entsprechen. Als Zertifikat wird LEED Gold angestrebt. Um einen möglichst umweltfreundlichen Betrieb des Büroturms zu gewährleisten, sind außerdem Geothermie, Grundwassernutzung sowie die Installation von Photovoltaik-Modulen vorgesehen.
Ob die beiden benachbarten Marina Towers zusammen ein ästhetisch gelungenes Paar bilden, bleibt dem persönlichen Geschmack vorbehalten.
4. HOHO Wien/A, 84 m
Das HoHo Wien (HoHo = Holzhochhaus) wurde mit viel Medienpräsenz vorgestellt. Es handelt sich um ein Holz-Hybrid-Hochhaus (Holz und Beton). Zentral gelegen in der Seestadt Aspern im 22. Wiener Bezirk Donaustadt im Westen Wiens, direkt an der U-Bahnstation Seestadt.
Mit 24 Geschoßen und 84 Metern Höhe ist es aktuell das weltweit dritthöchste Holzhochhaus, das bereits bewohnt ist. Die Mischnutzung beinhaltet in den unteren Stockwerken Gewerbe, Fitness- und Beauty-Center, Restaurants, Cafés und Büros. In den mittleren Etagen befinden sich flexible Büroflächen, die modernen Arbeitsanforderungen gerecht werden. Die oberen Stockwerke beherbergen ein Hotel sowie exklusive Apartments, die einen atemberaubenden Blick über Wien und die umliegende Seestadt Aspern bieten.
Keep it simple - der Hochhausbaukasten
Die konstruktive Merkmale des HoHo Wien sind auf raffinierte Weise „einfach“, ein modulares Stecksystem mit tiefer Vorfertigung. Das System basiert auf der Stapelung vier vorgefertigten, seriellen Bauelementen: Stützen, Unterzug, Deckenplatten und Fassadenelemente. Bei Statik und Tragwerksplanung wurde ein Optimum aller Anforderungen erreicht. Diese bestehen aus Schallschutz, Brandschutz und Robustheit, aber auch Wirtschaftlichkeit.
Einsatz von Beton war nötig wegen Schallschutz, Schalldammung und Spannweite. Gegenüber reinen Betondecken sind die Verbunddecken rund 1/3 leichter.
Die Holzbauweise spart gegenüber einer Ausführung in Stahlbeton rund 2.800 Tonnen CO?-Äquivalente ein. Das entspricht ca. 20 Millionen PKW-Kilometer
Ambiente – Arbeiten und Schlafen wie im Holzhaus.
Innen dominiert meist naturbelassenes Fichtenholz. Für die Decken kommen Holzbetonverbundfertigteile zum Einsatz. Die Mischbauweise von Holz und Beton ist im HoHo Wien nicht nur aus ökologischer sowie wirtschaftlicher Sicht effizient umgesetzt: die progressive Holz-Technik erlaubt, dass die Wände, Decken und Stützen komplett unverkleidet aus Fichtenholz verbleiben und so innen eine einzigartige, gemütliche Atmosphäre schaffen.
Was die Büros betrifft, sei Arbeiten hier wie ein Waldspaziergang, flötet die Immobilienfirma.
5. Mjøstårnet Brumunddall/NO, 85 Meter
Der Mjøstårnet Holzturm befindet sich in Brumunddal, einer kleinen norwegischen Stadt mit 10 000 Einwohnern, etwa eine und eine halbe Stunde Autofahrt nördlich von Oslo. Mjøstårnet bedeutet „der Turm am Mjøsa-See“. In einer flachen Landschaft bietet der 85,4 Meter hohe Holzturm eine imposante Erscheinung und einen weiten Blick über das Wasser und die umgebende Landschaft am Rande von Norwegens größtem See Mjøsa.
Echter Holzbau ohne Betonaussteifung
Mjøstårnet ist kein Hybridbau, sondern eine nahezu rein hölzerne Konstruktion. Nach einer Hintergrundinformation des Portals baunetzwissen.de wünschte sich „der Investor, der an
diesem größten See Norwegens aufgewachsen ist, ein Hochhaus aus dem Baustoff Holz, wobei nicht das Material an sich, sondern auch sein nachhaltiger Anbau, seine regionale Herkunft und Verarbeitung berücksichtigt werden sollten.“
Ehrgeizigerweise wollte man auch einen Höhenrekord für Holzhäuser aufstellen. 2019 fertiggestellt erhielt Mjøstårnet von der CTBUH das Siegel „Höchstes Holzhaus der Welt“ und musste es erst 2022 an ein amerikanische Gebäude abgeben. Dass die 3 Meter hohe Pergola am Dach, eigentlich nur eine Holzkonstruktion, mitgezählt wird, ist im Hochhausbau ein üblicher Trick, die Höhe noch paar Meter zu strecken.
Das Mjøstårnet wurde vom norwegischen Architekturbüro Studio Voll Arkitekter für AB Invest entworfen. Da die wichtigsten vertikalen Strukturelemente, die lastaufnehmenden Querstreben und die Deckenspannsysteme des Hochhauses aus Holz bestehen, gilt das Gebäude als Vollholzkonstruktion. In den oberen sieben Stockwerken wurden holzverkleidete Betonplatten verwendet, um Kriterien bezüglich Komfort (als Schwingungsdämpfer) und Akustik zu erfüllen sowie mehr Stabilität bei starken Winden zu erreichen.
Die auch aufgrund des Brandschutzes großzügig dimensionierten Stützen, Träger und diagonalen Streben des primären Tragwerks bestehen aus Brettschichtholz (CLT). Die konstruktiven Elemente haben in der Regel einen Durchmesser von 60 mal 60 Zentimeter. Meist wurde gleich mehrere Geschoße zusammengesetzt und mithilfe von Kränen in der Höhe montiert.
Ebenfalls aus Holz: Außenwände und Fassade
Die Außenwände wurden als Sandwichpaneele in Holz vorgefertigt und mit einer nicht-brennbaren Dämmung versehen. Verkleidet wurden diese Außenpaneele mit Kieferholzplatten, die ebenfalls den Brandschutznforderungen genügen müssen. Um die Nüchternheit der an sich glatten Holzfassade zu mildern, wurden in unregelmäßigen Abständen Leisten montiert, durch die sich eine reliefartige Struktur ergibt. Durch diese Gestaltung wird die Fassade mit Textur und Schattenwurf belebt.
Lebendige Mischnutzung
Mit einer Grundfläche von nur 17 Meter in der Breite und 37,5 Meter in der Länge ist jedes Stockwerk etwa 640 m2 groß. Die Gesamttnutzfläche des Turms beträgt etwa 10 500 m². An den Turm schließt unmittelbar ein niedrigerer Bau mit einem öffentlichen Schwimmbad an mit 4 900 m². Die zwei 25-Meter-Becken befinden sich im Erdgeschoss dieses Nebengebäudes das in gleicher Weise aud Holz besteht.
Eine lebendige Mischnutzung zeichnet den Mjøstårnet aus. Er beherbergt ein Restaurant, Büro- und Konferenzräume, ein Hotel sowie und Wohnungen untergebracht. Diese Apartments, die vor allem in den Stockwerken 12 bis 16 angeordnet sind, besitzen
großteils Balkone, die sich zum See hin orientieren.. Wer den Turm nur kurz besuchen will, kann die öffentlich zugängliche Dachterrasse erklimmen und den weiten Blick genießen.
Mjøstårnet erhielt große Aufmerksamkeit, sowohl National als auch International, gewann Auszeichnungen wie die Norwegische Tech Award 2018 in der Kategorie "Building and Construction" und die Gold-Medaille bei der New York Design Awards, für "Architektur-Gemischte Nutzung-International."
Foto Restaurant: AB Invest/https://abinvest.no/nyheter/verdens-hoyeste-trehus
Bild: Øystein Elgsaas/Vollarkitekter, Trondheim
6. Rocket Winterthur/CH, 100 m
Auf dem Areal der ehemaligen Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM), mitten in Winterthur, ensteht ein großflächiges neues Quartier. Als Referenz an seine Industriegeschichte erhielt das Areal den Namen Lokstadt. Alle neu zu errichteten Gebäude des neuen Stadtteils tragen die Namen der Lokomotiven, die hier einst gebaut wurden: Krokodil, Tigerli, Roter Pfeil, Elefant, Bigboy und Rocket.
Das Holzhochhaus Rocket entsteht als Ensemble mit niedrigeren Gebäuden namens Tigerli. Das Hochhaus wird 32 Stockwerke umfassen und eine Höhe von 100 Metern erreichen. Damit ist es eines der höchsten, sich in Planung befindlichen Wohngebäude aus Holz.
Der multinationale Immobiliendienstleister Implenia entwickelt und realisiert das Projekt „Rocket & Tigerli“ im Auftrag von Cham Swiss Properties. Die zukunftsweisende Arealentwicklung setzt neue Massstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit sowie moderne Holz- und Hybridbauweise. Die innovative Holzkonstruktion wurde von Implenia, der ETH Zürich und dem Bauingenieurbüro Walt Galmarini entwickelt. Das Siegerprojekt stammt von Schmidt Hammer Lassen Architects aus Kopenhagen und Cometti Truffer Hodel Architects aus Luzern.
m Gebäudekomplex mit 32 Stockwerken und einer Nutzfläche von ca. 26'000 Quadratmeter wird es 93 Miet- und ebenso viele Eigentumswohnungen geben. Im Sockelbereich Tigerli entstehen Gewerbeflächen, gemeinnütziges Wohnen und ein Hotel. Die neue Art der Urbanität, die man hier anstrebt, zeichnet sich nicht nur durch den Holzbau aus, sondern auch durch den Nutzungsmix und die individuelle Planung. So lassen sich von den künftigen Mietern mit kleineren Wohnungen auch Co-Working-Spaces anmieten. Zudem verfügt das Rocket über ein Dachgeschoss, das öffentlich zugänglich ist und eine fantastische Panoramasicht auf die Stadt bieten wird.
Rocket mit Hybrid-Konzept
Das Hochhaus ensteht in Holzhybridbauweise mit mit neu entwickeltem Tragsystem und innovativer Holzverbundflachdecke. Diese neu entwickelte Deckenkonstruktion,kommt mit
möglichst wenig Hochleistungswerkstoffen aus um möglichst viel Beton zu ersetzen. ersetzt. Die Wände werden in Leichtbauweise mit Holzkonstruktion ausgeführt. Die Tigerli-Bauten hingegen werden in traditioneller Massivbauweise aus Stahlbeton und Backstein errichtet.
Die klimafitte Rakete
Abgesehen vom nachwachsenden Baustoff Holz setzt die Lokstadt auf ganzheitliche Nachhaltigkeit. Dafür soll das gesamte Stadtviertel als 2000-Watt-Areal zertifiziert werden. Die Schweiz hat zurzeit einen Wert der stetigen Leistung von circa 5000 Watt pro Kopf.
Zusätzlich sollen Dächer als begrünte Lebensräume gestaltet werden und so zu einer weiteren Kühlung des Mikroklimas beitragen. Zum anderen will man auf unversiegelte Flächen setzen, die durch Bäume, Büsche und Wasserlachen das Klima im Sommer regulieren.
Rocket und das siebengeschossige Nachbarhaus Tigerli werden voraussichtlich 2026 fertiggestellt und bezugsfertig sein.
BU Ist die Winterthurer Lokstadt fertig gebaut, sticht das Hochhaus als neue Landmarke hervor.
Bilder: © Implenia Media Picturepark/ DesignRaum GmbH
7. Oakwood Timber Tower London/GB, 300 m
Der Oakwood Timber Tower ist die fantastische Vision eines Woodscrapers im Herzen von London. Er soll 300 Meter in den Himmel ragen und sich mit dem höchsten Gebäude der Stadt messen. Höher ist in London derzeit nur „The Shard“ mit 310 Meter, vom Architekten Renzo Piano. Diese sehr spitze Glaspyramide ist auch höchstes Gebäude Westeuropas. Mit seinen geplanten 300 Metern wäre der Oakwood Timber Tower dann das zweithöchste Gebäude Londons.
Der Konzeptentwurf für den Oakwood Timber Tower, der als Wohnsiedlung geplant ist, stammt von PLP Architecture in Zusammenarbeit mit dem Centre for Natural Material Innovation der Universität Cambridge sowie den Smith and Wallwork Engineers. Über das konkrete Projekt hinaus geht es auch um Grundlagenforschung und Strategien für den Einsatz von Holz im Hochhausbau. Das Team untersuchte die strukturellen Möglichkeiten und die gesundheitlichen Vorteile von Wohnhochhäusern aus Holz.
Mit Brettsperrholz zum Durchbruch
In einem Interview sagte Kevin Flanagan, leitender Architekt des Oakwood Timber Tower-Projekts, „Brettsperrholz-Modulplatten können oft in einem Drittel der Zeit, mit deutlich weniger Arbeitskräften und deutlich weniger Lärm als Betonelemente gebaut werden“ Und „ein Holzgebäude ist von Natur aus sehr leicht und erfordert weniger tiefe Fundamente. Daher eignen sie sich ideal für Standorte in Großstädten“.
Innovativer Bauweise mit einer Jump Factory
Das Gebäude ist nach einem modularen Bausatz konzipert, der mit einer einzelnen Planke beginnt und in einem mehrstöckigen, verstrebten Bündelelement endet. Die Bauweise basiert auf einer robotischen „Jump Factory“, einem Mechanismus, der mit dem Gebäude mitklettert und so die Montage von Struktur, Böden und Innenwänden wie unter Fabrikbedingungen vor Ort ermöglicht.
Eine „Jump Factory“ beim Holzhochhausbau (auch climbing factory genannt) funktioniert ähnlich wie beim Betonbau, ist aber speziell auf die Anforderungen von vorfabrizierten Holzbauteilen abgestimmt. Sie bezeichnet hier kein klassisches Schalungssystem, sondern vielmehr eine mobile, geschlossene Montagehalle, die geschossweise mit dem Gebäude mitwächst.
Holzhochhaus mit über 1000 Wohnungen
Die derzeit entwickelten Konzeptvorschläge sehen die Schaffung von über 1.000 neuen Wohneinheiten auf 80 Etagen in einem 93.000 Quadratmeter großen Mehrzweckturm und mittelhohen Reihenhäusern im Zentrum Londons vor. Integriert ist der Oakwood Timber Tower in das Barbican-Gebäude, ein denkmalgeschützte Wohnkomplex aus Beton, der sich eher dem Brutalismus verpflichtet sieht. So erhebt sich der Holzturm über die CO2-verschwenderischen Brutalismus-Architektur aus Beton wie ein Ausrufezeichen für die Zukunft nachhaltigen Bauens.
Der Horror - Brände in Holzhochhäusern
Die größte Sorge potenzieller Bewohner von Häusern, die überwiegend aus Holz gebaut sind, ist die Brandgefahr. Feuerwehrleitern reichen nur bis 70 Meter. Das Projektteam erklärte jedoch, dass das geplante Gebäude letztendlich alle geltenden Brandschutzbestimmungen für Stahl- und Betongebäude erfüllen oder übertreffen werde.
Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Forschungsphase. Ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten arbeitet intensiv an der Machbarkeit des gigantischen Holzturms. Dabei forschen sie auf allen Ebenen – von der mikroskopischen Zellstruktur des Holzes bis hin zur Widerstandsfähigkeit des Hochhauses gegenüber starken Winden.
Die zahlreichen Innovationen die beim Oahwood Tower einfließen, werden auch anderen Holzhochhäusern zugute kommen.
8. River Beech Tower Chicago/USA 280 m
Als sich die Architekten bei Perkins & Will mit Forschern der Universität Cambridge und Ingenieuren bei Thornton Tomasetti zusammenschlossen, ging es um die völlige Neuentwicklung eines rund 280 Meter hohen Wohnturms aus Massivholz. Der modulare River Beech Tower-Entwurf ist mit seinen 80 Geschossen ein Wolkenkratzer, der seine enorme Höhe ganz ohne Stahl und Beton erreichen soll. Rund 300 Wohnappartments soll der Turm beherbergen.
Die Planer nennen ihren neuen Denkansatz eine „Revolution im nachhaltigen Wolkenkratzer-Design“. Es geht um nichts weniger als die bisherigen statischen Limits, die dem Baumaterial Holz nachgesagt werden, aufzuheben. Während andere versuchen würden, Betonkonstruktionen in Holz umzusetzen, hätten sie bei ihren Überlegungen bei Null begonnen. Als Ausgangsparameter dienten lediglich die derzeit am Markt befindlichen Holzprodukte Brettsperrholz (CLT) und Brettschichtholz (engl. Glulam). Während sich das kreuzverleimte Sperrholz gut für tragtende Wand- und Deckenplatten eignet, liegen die Vorteile bei Brettschichtholz im Einsatz bei tragende Balken und Stäben.
Daraus entwickelten Sie eine Gebäudehülle in Form einer hochsteifen Gitterstruktur.
Ein Tragwerksystem mit sich überkreuzenden Trägern, ein sogenanntes Diagrid, das modular mit Brettschichtholz aufgebaut ist. Diese netzartige Struktur ist doppelt vorhanden, außen und innen. Durch die kraftschlüssige Verbindung beider Strukturen erfolge eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Holzelemente, erläutern die Planer. In einem interview erklärte Andrew Tsay Jacobs, Leiter des Building Technology Labs von Perkins + Will: „Mit Holz lassen sich problemlos 80 Stockwerke bauen. Die Hürden liegen nicht so sehr auf der technischen, als auf der Seite der Bauverordnungen.“
Die CO2-Einsparung von solchen Holzhochhäusern wäre gegenüber konventionellem Stahlbetonbau enorm. Perkins Will betonen: „Der Massivholzbau ist aufgrund der Verwendung erneuerbarer Materialien und der modularen Fertigung, bei der nur sehr wenig Abfall und Kohlendioxidemissionen entstehen, äußerst nachhaltig.“ Ob und wann das Projekt realisiert wird, ist derzeit noch unklar.
9. WOHO Berlin/D, 98 Meter
Die Immobilienpreise steigen, aber Berlin braucht Wohnungen. Ein möglicher Ausweg ist das Bauen in die Höhe. Das hat auch der Berliner Senat erkannt und Anfang 2020 das „Hochhausleitbild“ für Berlin beschlossen. Es soll einen Interessenausgleich zwischen der Notwendigkeit der Innenverdichtung, den Investitionsabsichten des Immobilienmarkts und den Wünschen und Bedürfnissen der Stadtgesellschaft leisten.
Auf sehr ungewöhnliche Weise folgt dieser Idee das Woho Berlin. WoHo bedeutet schlicht Wohnhochhaus. Geplant mit einer Höhe 98 Meter, entstehen auf 29 Geschoßen rund 150 Wohnungen im Stadtteil Kreuzberg. Die Gesamtnutzfläche beträgt 8.000 qm. Das WoHo soll in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet werden. Die Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte der Baukörper werden als Stahl-Beton-Konstruktion ausgeführt, der Rest der tragenden Konstruktion wird aus Holz bestehen.
Formal handelt es sich um vier Kuben, leicht versetzt übereinandergestapelt sind. Eine muntere Ästhetik, die zu gefallen weiß.
Nutzung als Kreuzberger Mischung
Ungewöhnlich ist aber nicht nur die Holzhybridbauweise sondern auch das Nutzungskonzept. Wie schon bei anderen Quartieren des Berliner Projektentwicklers UTB sollen im Sockelbereich des Wohnturms soziale Einrichtungen und Träger Platz finden: Kita, Hort, Kiezkantine, betreutes Wohnen für Jugendliche und Demenzkranke, Familienwohnungen, Ateliers und Gewerbeeinheiten. Ein öffentlicher Zugang aufs Dach, so wird versprochen, soll dort einen fantastischen Rundblick über Berlin ermöglichen. 50 der geplanten 150 Wohnungen müssen mietpreisgebunden sein, 6,50 Euro nettokalt den Quadratmeter. Deutlich hochpreisiger werden dagegen die frei finazierten Eigetumswohnungen ausfallen. Die gemischte soziale Struktur könnte Sprengstoff bieten.
Umstrittenes Nutzungskonzept
In einem Beitrag des Deutschlandfunks äußerte sich der zuständige Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt von Bündnis 90/Die Grünen über das Woho, es könne „die Funktion eines Pilotprojektes mit Leuchtturmcharakter haben, das weit über Berlin hinaus ein Zeichen setzt, dass der Umbau der Stadt hin zu einem sozialen und ökologischen Paradigmenwechsel möglich ist.“
Ganz anders sieht das John Dahl von der SPD, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Bezirk. Er glaubt nicht an die Idee des gemischten Quartiers in der Vertikalen. „Sprich: Von den Großkopferten bis zu den Benachteiligten, alle kommen irgendwie unter, und das soll dann irgendwie funktionieren.“ Hier seien die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit mit solchen Projekten, zumindest in West-Berlin und in Westdeutschland gemacht habe, eher negativ gewesen. Kurz gesagt, die Mischung passt nicht zusammen.
Manche Anwohner äußerten sich auch kritisch was die Höhe betrifft. Sie befürchten Schattenwurf und die typischen (Fall-)Winde, die von Hochhäusern verstärkt werden können. Maßnahmen gegen den Wind, die in der Planung schon berücksichtigt werden sollten, sind Sockel- oder Vordächer, aber auch Bäume, Hecken und Sträucher auf den Freiflächen.
Dennoch ist der Städtebauliche und ökölogische Mehrwert nicht von der Hand zu weisen. Das Projekt befindet sich derzeit im Bebauungsplanverfahren. Vor zwei Jahren ist nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Größere Baumaßnahmen könnten sich in Berlin traditionellerweise auch noch etwas länger hinziehen.
10. Wood up, Paris/F, 50 m
Nahe dem Pariser Seine-Ufer, im aufstrebenden 13. Arrondissement, erhebt sich die „Wood Up“-Wohnanlage. Eines der ersten reinen Wohntgebäude, das weitgehend mit Holz gebaut wurde und ein besonders nachhaltiges Konzept verfolgt. Mit seiner menschenfreundlichen Höhe von 50 Metern enthält das Wood up unter anderem 132 Wohneinheiten. Die Fertigstellung war im Juli 2024, nachdem der Bau im Oktober 2021 begann.
Das Wood up ist Teil der groß angelegte Stadtentwicklungsinitiative Paris Rive Gauche. Sie umfasst die gesamte Ostseite des 13. Arrondissements und soll entlang des linken Seine-Ufers ein Viertel schaffen, das eine neue Stadtlandschaft von großstädtischem Ausmaß formen wird. Was für manche erstmal bedrohlich klingt, soll aber in ein lebensfreundlich-
lebendiges Viertel münden, mit viel Grün und Fahrradwegen. Seit der Olympiade setzt Paris verstärkt auf Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit.
Wood up – nachhaltig nicht nur als Bau
Bei dem Projekt stand ein ökologisches und nachhaltiges Konzept im Mittelpunkt. Das für den Bau verwendete Holz stammt aus Frankreich: Die konstruktiven Pfosten und Pfähle im Inneren des Gebäudes bestehen aus Buchenholz, für Balken wurde Fichte verwandt. Pfosten im Außenbereich sind aus Douglasie, die sehr feuchtigkeitsresistent ist. Da das Holz teilweise aus der nahen Normandie kam, wurde das Material unter anderem über die Seine transportiert. Der Bau der hölzernen Wohnanlage soll aufgrund der innovativen Bauweise einen bis zu 60 Prozent geringeren CO?-Ausstoß aufweisen als eine vergleichbare Betonkonstruktion. Um den ökologischen Aspekt des Projekts noch zu steigern, so ermittelte die Architekturzeitschrift AD, verpflichtete sich der Bauherr, im Anschluss 14.000 Bäume neu anzupflanzen. „Die Idee war, ein Gebäude mit Symbolcharakter zu errichten“, so der Auftraggeber.
Ruhige Rasterfassade
Die streng gegliederten Holzfassade des Wood up erinnert ein wenig an ein skandinavisches Möbelstück oder ein Bücherregal. Nicht besonders spektakulär, strahlt sie eher eine ruhige Autorität aus. Durchaus wohltuend vor der Kulisse der ebenfalls neu entstandenen Zwillingstürme in Hintergrund. Die Tours Duo genannten Zwillingstürme ragen mit ihrer expressiv windschiefen Stahl-Glas-Architektur 180 und 120 Meter in die Höhe. Zu dieser schepsen Großskulptur bildet das ruhige, fast warme Wood up einen versöhnlichen Kontrapunkt, das am Seine-Ufer nicht unnötig auftrumpfen will.
Zu den spektakulärsten Räumlichkeiten des Wood up gehören eine 300 Quadratmeter große Terrasse mit Blick auf Paris, ein Dachgarten sowie eine geräumige und einladende Lobby. Begegnungszentren, die für alle Bewohner nutzbar sind.
11. W 350 Tokio/JP, 350 Meter
Es klingt wie Science Fiction: Ein Wolkenkratzer mit 350 Meter Höhe zu 90 Prozent aus Holz gebaut. Doch die Pläne sind real. Denn damit will sich der japanische Holzbaustoffgigant Sumitomo Forestry zu seinem 350. Firmenjubiläum ein eigenes Firmendenkmal setzen. Jeder Meter steht für ein Jahr Firmengeschichte. Das Jubiläum findet 2041 statt, dann soll auch der W 350 pünktlich fertig sein. Für so ein Gigaprojekt ist diese Vorlaufzeit keineswegs großzügig bemessen.
Der W 350 soll aber nicht nur ein Firmenmonumet werden, sondern auch eines für ökologische nachhaltige Holzbauweise. Dieser hat sich die Sumitomo Forestry mittlerweile verschrieben, praktisch auch durch üppige Neuanpflanzungen von Wäldern. Es soll wieder mehr Natur in die ansonsten von Stahl und Beton dominierte Innenstadt Tokios zurückgebracht werden, zumal Holz oder Bambus als Baumaterial in Japan Tradition haben. Nicht nur als Baustoff auch als Lebensphilosophie.
Der Plyscraper (eine Bezeichnung für Holzhochhäuser) soll 70 Geschosse umfassen. Als verwendete Hölzer sind japanische Zedern- und Zypressenhölzer vorgesehen. Diese ölhaltigen Hölzer sind sehr witterungsbeständig.
Holzhochhäuser in dieser Dimension müssen entsprechende Anforderungen erfüllen. Neben den üblichen sind vor allem Brandschutz ein Thema und in Japan allgemein Erdbebensicherheit. Japan liegt auf einer Zone, in der zwei Kontinentalplatten zusammenstoßen. Jährlich erschüttern um die 5000 kleinere und größere Erdbeben das Land. Für eine Grundstabilität des W 350 sollen vier gigantische Stützpfeiler aus verleimten Konstruktionsholz sorgen, jeweils über zwei Meter stark. Das gesamte Holztragsystem aus ca. 185 000 m³ Zedern- und Zypressenholz wird entlastet über eine filigrane, außenliegende, aus diagonal angeordneten Rohren bestehende Stahlkonstruktion. Der Stahlanteil soll insgesamt aber nur 10 Prozent betragen.
Was den Brandschutz betrifft, so halten Brettschichtverbund- und Leimbinder-Hölzer mit einem entsprechend großen Durchmesser einem Brand ebenso Stand, wie vergleichbare Stahlbetongewerke. Sumitomo Forestry leistet sich auch ein firmeninternes Forschungszentrum, das Tsukuba Research Institute. Hier forscht man an weiteren Brandschutzmaßnahmen, die derzeit aber noch nicht veröffentlicht werden.
Es gibt aber bereits ein dreigeschossiges Testgebäude im Maßstab 1:1, an dem diverse Untersuchungen und Tests durchgeführt werden können.
Interieur mit Biosphärencharakter
Ein gigantisches Atrium im Inneren des Wohnturms soll bis zur Spitze des Gebäudes reichen. So entsteht eine enorme Luftigkeit. Um das Atrium gruppen sich alle einzelnen Etagen. Balkone auf allen vier Seiten ermöglichen es den Bewohnern und Besuchern ins Freie zu gelangen und die Aussicht zu genießen. Durch Bepflanzungen der hölzernen Außenfassade soll die Wirkung eines urbanen Biotops entstehen. Das könnte auch zum Lebensraum für Vögel und Insekten werden. Falls die stärkere Windlast in den Höhen keinen Strich durch dieses Ansinnen macht. Das Dach soll den Bewohnern als Naherholungsgebiet in Form eines großflächigen Gartens dienen.
Die hehren Ziele dieses Projekts spiegeln sich allerdings auch in den Kosten. Mit geschätzten 4,8 Mrd. Euro ist der W 350 Plyscraper fast doppelt so teuer wie ein Gebäude in konventioneller Bauweise. Löblich immerhin, dass die Japaner es ernst meinen mit der klimaangepassten Nachhaltigkeit.
Holzbau wird auch gefördert
Da Holzbau meist etwas teurer ist als Betonbau, sind Fördermaßnahmen willkommen. Es gibt eine Holzbauinitiative der Bundesregierung von 2023. Allerdings sind das eher Überlegungen als echte Maßnahmen. „In diesem Kontext unterstützt die Holzbauinitiative die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) zur Ausgestaltung einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial ausgewogenen und ökologisch verträglichen Entwicklung und trägt damit zur Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung (SDG) bei“, heißt es dort. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/holzbauinitiative.html
Konkreter wird das Bayerische Holzförderprogramm (BayFHolz) des Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr:
„Die Zuwendungshöhe beträgt 500 Euro je Tonne der in den Holzbauelementen und Dämmstoffen gebundenen Kohlenstoffmenge. Maßnahmen unter 25.000 Euro werden nicht gefördert. Die maximale Gesamtzuwendung beträgt 200.000 Euro je Baumaßnahme.“
Auch andere Bundesländer dürften den Holzbau fördern. hjk