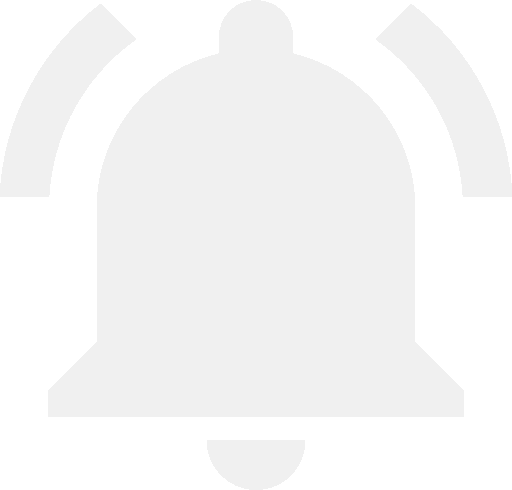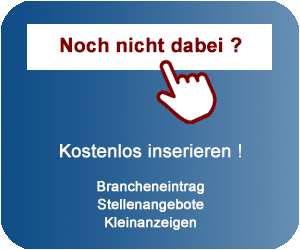Klischee ade? Frauen in Bauberufen
Frauen auf Baustellen sind immer noch eine Seltenheit – trotz wachsendem Fachkräftemangel und Bemühungen um Gleichberechtigung in der Arbeitswelt. Bauhelme und Sicherheitswesten scheinen oft fest in Männerhand, doch langsam bahnen sich auch Frauen ihren Weg in die Branche.
In vielen Kulturen arbeiteten Frauen seit jeher auf Baustellen, insbesondere in Zeiten des Arbeitskräftemangels wie während Kriegen. Bereits im Mittelalter waren Frauen oft an Bauprojekten beteiligt, beispielsweise als Wasserträgerinnen, Helferinnen oder sogar als Steinmetze, wenn sie aus Handwerkerfamilien stammten. Ein berühmtes Beispiel ist Sabina von Steinbach, die im 13. Jahrhundert am Straßburger Münster gearbeitet haben soll.
Während der beiden Weltkriege stieg die Zahl der Frauen in Bauberufen rapide an, da viele Männer an der Front waren. Nach den Kriegen wurden Frauen jedoch oft aus diesen Positionen verdrängt, als die Männer zurückkehrten.
In der DDR hingegen war die Beteiligung von Frauen am Bau fest in die Arbeitswelt integriert. Frauen wurden gezielt ausgebildet und gefördert, um Berufe wie Maurerin oder Kranführerin auszuüben. Gleichberechtigung war hier keine Theorie, sondern ein staatlich forciertes Ziel, das auch im Bauwesen sichtbar wurde.
Erst mit der Frauenbewegung und dem Wandel der Geschlechterrollen ab den 1970er-Jahren wurde der Berufszugang für Frauen im Bauwesen auch in westlichen Ländern breiter. Doch bis heute bleibt der Anteil gering – nicht zuletzt, weil Frauen noch immer mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben.
Das ist doch kein Beruf für eine Frau
Frauen im Bauwesen und Handwerk haben es nicht leicht – nicht etwa wegen der Arbeit selbst, sondern wegen der Vorurteile, die ihnen entgegenschlagen. „Das ist doch ein Männerberuf“ oder „Frauen sind dafür nicht stark genug“ sind nur zwei der vielen Sätze, die sie sich anhören müssen. Dabei ist längst bewiesen, dass körperliche Stärke trainierbar ist und moderne Maschinen vieles erleichtern. Aber Vorurteile halten sich hartnäckig – ganz egal, wie unbegründet sie sind.
Ein weiteres Klischee lautet: Frauen und Technik, das passt nicht zusammen. Dieses stereotype Denken ignoriert völlig, dass technisches Verständnis keine angeborene Fähigkeit ist, sondern gelernt werden kann – zumindest von allen, die daran interessiert sind. Und dann ist da noch der Klassiker: Frauen würden die Arbeitsatmosphäre stören. Es klingt fast absurd, aber manche glauben ernsthaft, dass eine Baustelle nur funktioniert, wenn sie rein männlich bleibt.
Hinzu kommt die Annahme, Frauen seien in „weiblicheren“ Berufen besser aufgehoben – am besten in solchen, die kreativ oder sozial sind. Als wären handwerkliche Berufe weniger kreativ! Und dass Frauen angeblich nicht für Führungsrollen geeignet sind? Auch das ist ein Vorurteil, das mehr über die Denkweise der Kritiker aussagt als über die Frauen, die es widerlegen.
Wer es als Frau trotz all dieser Vorbehalte in einen handwerklichen Beruf schafft, muss sich oft mit einem neuen Vorwurf herumschlagen: Sie sei nur wegen einer Frauenquote eingestellt worden. Das macht es nicht einfacher, sich in einer ohnehin männerdominierten Branche durchzusetzen.
Ganz nebenbei wird Frauen auch noch unterstellt, sie seien zu empfindlich für den oft rauen Umgangston auf Baustellen. Doch ist die Fähigkeit, sich durchsetzen zu können, tatsächlich eine Frage des Geschlechts? Und dann gibt es noch das strukturelle Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Frauen immer wieder als „persönliches Hindernis“ verkauft wird. Nimmt man es jedoch ganz genau, so gilt diese Herausforderung für alle Geschlechter gleichermaßen.
Doch allen Stolpersteinen und Vorurteilen zum Trotz finden immer mehr Frauen ihren Weg auf die Baustelle. Und das ist in Zeiten des Fachkräftemangels durchaus positiv zu bewerten.
Frauen im Bauwesen weltweit
Werfen wir nun einmal einen Blick in andere Länder und Kulturen. Wie ist es dort bestellt um die weiblichen Arbeitskräfte auf dem Bau:
Indien und andere asiatische Länder
In Indien ist es normal, dass Frauen auf Baustellen arbeiten, allerdings häufig in weniger spezialisierten Rollen wie Tragen von Baumaterialien oder Vorbereitungsarbeiten. Sie sind dort oft Tagelöhnerinnen und arbeiten unter sehr prekären Bedingungen mit geringer Bezahlung und ohne soziale Absicherung.
Skandinavien und Westeuropa
In Ländern wie Schweden und Norwegen, die für ihre Gleichstellungspolitik bekannt sind, gibt es vergleichsweise viele Frauen in Bauberufen, sowohl in handwerklichen Tätigkeiten als auch in der Bauleitung. Dort werden Frauen gezielt gefördert, etwa durch Stipendien oder Mentoring-Programme.
Afrika und Lateinamerika
In vielen afrikanischen Ländern arbeiten Frauen im informellen Bauwesen, vor allem beim Straßenbau oder der Ziegelherstellung. In Lateinamerika sind Frauen zunehmend auch in technischen und planerischen Rollen vertreten, etwa als Ingenieurinnen oder Architektinnen.
Deutschland und Mitteleuropa
In Deutschland machen Frauen etwa 15 % der Beschäftigten im Bauwesen aus, wobei der Großteil in administrativen oder technischen Berufen wie Architektur oder Bauingenieurwesen tätig ist. Handwerkliche Berufe wie Maurerin oder Dachdeckerin sind selten, aber die Zahlen steigen langsam.
Welche Tätigkeiten üben Frauen vorwiegend aus?
Frauen sind im Bauwesen in vielfältigen Rollen aktiv:
1. Handwerkliche Berufe: Maurerinnen, Malerinnen, Dachdeckerinnen, Installateurinnen.
2. Technische Berufe: Bauleiterinnen, Ingenieurinnen, Vermessungstechnikerinnen.
3. Spezialaufgaben: Restauratorinnen, Denkmalpflegerinnen, Kranführerinnen.
4. Planung und Management: Architektinnen, Projektmanagerinnen.
Jedoch ist zu beobachten, dass Frauen auf dem Bau immer noch wesentlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, selbst bei gleicher Qualifikation. In Deutschland liegt der Gender Pay Gap in der Baubranche bei rund 20 %. Der Gender Pay Gap beschreibt den Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen. Er gibt an, wie viel Prozent Frauen weniger verdienen als Männer, und wird oft als Maß für die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verwendet. Es gibt zwei Arten:
- Unbereinigter Gender Pay Gap: Dieser bezieht alle Verdienste ein, ohne Unterschiede wie Berufserfahrung, Branche oder Position zu berücksichtigen.
- Bereinigter Gender Pay Gap: Hier werden vergleichbare Faktoren wie Qualifikation, Beruf und Arbeitszeit mit einbezogen. Er zeigt, wie groß der Unterschied ist, wenn Frauen und Männer in vergleichbaren Jobs arbeiten.
Der Gender Pay Gap ist also ein Indikator für strukturelle Ungleichheiten, die z. B. durch die Berufswahl, Teilzeitquoten oder mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten entstehen können. Hier ist noch Luft nach oben.
Zukunftsaussichten: Frauen auf dem Bau
Mit dem Fachkräftemangel steigt die Nachfrage nach Frauen im Bauwesen. Initiativen wie spezielle Ausbildungsprogramme, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie gezielte Förderungen tragen dazu bei, den Anteil von Frauen in der Branche zu erhöhen. Auch die zunehmende Automatisierung und der Einsatz von Maschinen verringern körperliche Barrieren und machen handwerkliche Tätigkeiten für Frauen zugänglicher.
Frauen auf dem Bau bringen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch Diversität, Kreativität und Teamfähigkeit in eine Branche ein, die traditionell männlich geprägt ist – und darf durchaus als Gewinn für alle Beteiligten gewertet werden. kw
Bild: Adobe KI
Redaktion
Weitere Inserate des Anbieters |