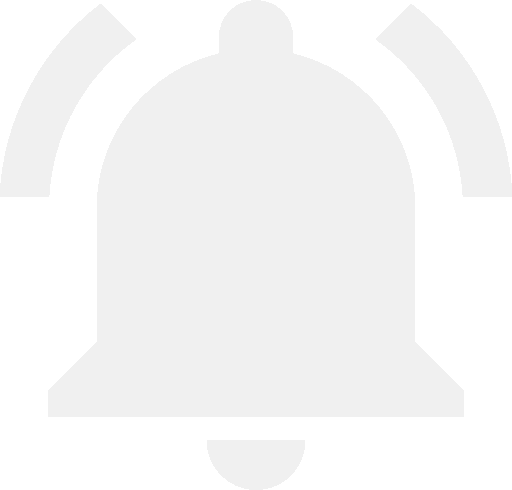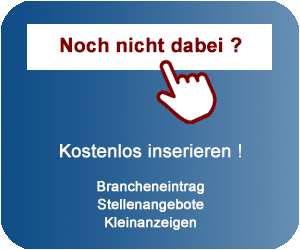Ein 500 Milliarden-Wumms für die Infrastruktur
Lange hat es die Baubranche und andere gefordert, jetzt konnte sich auch die Politik dazu durchringen. Am 4. März 2025 verständigten sich Union und SPD in ihren Sondierungen für eine neue Bundesregierung unter anderem darauf, ein Sondervermögen mit kreditfinanzierten 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur zu schaffen.
Marode Bahngleise, kaputte Brücken und holprige Straßen sollen repariert, Schulen und Kitas saniert, Strom- und Wärmenetze ausgebaut werden. Und vieles mehr. Das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik entspricht im Vergleich etwas mehr als das Volumen des ganzen Bundeshaushalts.
Das Geld soll schnell zur Verfügung stehen und über zehn Jahre abfließen.100 Milliarden Euro davon sind für die Bundesländer und Kommunen vorgesehen. Damit das an der Schuldenbremse vorbeilaufen kann, soll das Sondervermögen im Grundgesetz verankert und dort von der Schuldenregel ausgenommen werden.
Für die Grundgesetzänderung wird allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt. Im alten Bundestag ginge das noch mit den Stimmen der Grünen. Im neuen Bundestag ab 25. März 2025 könnten AfD und Linke diese Abstimmung (aus unterschiedlichen Gründen) per Sperrminorität blockieren. Die Pläne müssen also jetzt noch durch den alten Bundestag.
Die Bauindustrie applaudiert
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer im Zentralverband Deutsches Baugewerbe hatte einen solchen Schritt ansatzweise bereits vor einigen Monaten geäußert. Jetzt sieht er in den geplanten Investitionen eine "dringend benötigte Modernisierungsoffensive". "Wir erwarten nicht nur wirtschaftliche Impulse, sondern auch eine Stärkung unserer nationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Bauwirtschaft ist froh, dass Schwarz-Rot diesen Schritt gehen will."
So weist Sebastian Dullien, Direktor des gewerkschaftsnahen Forschungsinstituts IMK, darauf hin, dass bei einer schnellen Umsetzung des Finanzpakets bereits in der zweiten Jahreshälfte mit deutlichen Impulsen zu rechnen sei: „Und das Wachstum für das Gesamtjahr könnte sich schon spürbar von der Stagnation wegbewegen. Für die kommenden Jahre wären dann wieder normale Wachstumsraten von 2 Prozent pro Jahr möglich.“
Im Endspurt zur Bundestagswahl hatten die Unionsparteien Lockerungen der Schuldenbremse eher ausgeschlossen.
Beispiel Brücken
Insgesamt gibt es nach Angaben des früheren Verkehrsministeriums unter Volker Wissing (FDP) rund 40.000 Autobahn- und Bundesstraßenbrücken, davon müssten etwa 4000 Brücken saniert werden. Sein damals ehrgeiziger Plan, das Tempo auf 400 Brückensanierungen pro Jahr zu verdoppeln und den Sanierungsstau bis 2032 bewältigt zu haben, droht zu scheitern. Im Januar 2025 bezeichnete der Bundesrechnungshof dieses Ziel als "gänzlich unrealistisch".Das liege an fehlendem Personal und Fehlplanungen bei der zuständigen Autobahn GmbH. Im vergangenen Jahr habe die bundeseigene Gesellschaft nur 238 Projekte abgeschlossen, wohingegen jährlich 438 Brückensanierungen notwendig seien, so die Kontrolleure. Zumindest am Geld scheitert es jetzt nicht mehr. Der Fokus liegt auf der Umsetzung, also Planung, Genehmigung und Ausführung.
Mit Bezug darauf weist Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes HDB, im einem Interview daraufhin, dass, sobald es konkreter wird, die Verwaltungen für Tempo sorgen müssten. Noch deutlicher wird Michael Hüther, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): damit das Geld auch tatsächlich schnell fließt, „brauchen wir ein Gesetz, das die Planungs- und Genehmigungszeiten beschleunigt“.
Die Bahnsanierung nicht vergessen
Christian Bernreiter (CSU), u.a. Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, möchte, dass die Mittel für alle Verkehrsträger und ihre jeweils spezifischen Finanzierungsbedarfe zur Verfügung stehen müssen: „Der Investitionsbedarf in Bezug auf die Schieneninfrastruktur des Bundes ist hoch. Mir ist dabei wichtig, dass Investitionen nicht nur in die Hochleistungskorridore fließen, sondern auch in die Fläche. Neben der Schieneninfrastruktur, wozu auch barrierefreie Bahnhöfe gehören, geht es aber auch um die dringend benötigte Sanierung von Brücken und Lückenschlüsse im Straßennetz.“ Trotz der Höhe des Sondervermögens darf das nicht alles sein. Bernreiter weiter: „“Gleichzeitig darf aber auch an den laufenden Mitteln nicht gespart werden. Zum Beispiel brauchen die Länder weiterhin eine verlässliche Ausstattung über die Regionalisierungsmittel, damit auf den sanierten Trassen auch weiterhin Züge fahren.“
Sondervermögen - die smarten Schulden
Kritiker sprechen dagegen von Schattenhaushalten oder kreativer Haushaltsführung. Auch der Bundesrechnungshof ist kein Befürworter. Insgesamt zählte der Bundesrechnungshof 29 existierende Sondervermögen, von denen die ältesten aus den 1950er Jahren stammten. Deutschland sitzt auf einem Schuldenberg von insgesamt 1,7 Billionen Euro, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. 2024 mussten 33 Milliarden Euro im Haushalt für Zinszahlungen aufgebracht werden.
Gretchenfrage der Zukunftsgestaltung
Der Streit darüber, ob eine funktionierende Infrastrukur die richtige Investion in die Zukunft sei oder ein möglicht schuldenfreier Haushalt den Bürgerinnen in Zukunft mehr Freiheiten böte, ist so alt wie die Bundesepublik. hjk
Foto: Erich Westendarp/pixabay
Schwarzmeier GmbH - Neue Medien
Weitere Inserate des Anbieters |